Donatella Di Cesare: Philosophie der Migration
Verantwortlich denken und reden im Zeitalter der Migration
Gastbeitrag von Katrin Büttner[*]
Nach der Flüchtlingskrise 2015 schrieb Di Cesare das Buch Stranieri Residenti (Ansässige Fremde), 2017 in Italien, als Philosophie der Migration 2021 in deutscher Übersetzung erschienen.
Sie plädiert darin für das Recht zu emigrieren, für ein ius migrandi als zentrales Recht des 21. Jahrhunderts.
In ihrer Philosophie der Migration setzt die Autorin an bei unseren Denk- und Sprechgewohnheiten. Sie untersucht die Bedeutung der Begriffe im Wandel der Zeiten und ihre Stellung innerhalb der Philosophie; sie mahnt ein „Bürgerrecht“ des Migranten in der Philosophie an. Als Philosophin hinterfragt sie das scheinbar Fraglose und Selbstverständliche, bedenkt das Ungedachte oder bedenkenlos wiederholte.
Auf dem Prüfstand stehen unser Denken und Reden strukturierende Begriffe wie Staat, Migration, Exil, Asyl, Flüchtling, Demokratie, Grenze, Aufnahme, Gastfreundschaft, Wohnen.
Auch ohne unmittelbare einfache Antworten könnten auf diesem Wege Grenzen, Grenzen des Denkens und der Vorstellungskraft, durchlässig werden, und Visionen ins Spiel kommen, die nicht den Arzt benötigen, sondern unseren Horizont erweitern.
Zurückgewiesen werden damit die gängigen Fragestellungen: Wie drängen wir die „Ströme“, die „Flut“ zurück? Wie schützen wir die Grenzen? Wie viele können wir aufnehmen? Wie verhindern wir illegale Migration? Nach welchen Kriterien lassen sich „Geflüchtete“ und sogenannte Wirtschaftsmigranten unterscheiden? Auf welche Weise wären sie zu „integrieren?“
Zur Person:
Di Cesare wurde 1956 in Rom geboren, ist Professorin für Theoretische Philosophie und lehrt und forscht an der Universität La Sapienza in Rom. Sie studierte u. a. in Tübingen und Heidelberg, war Schülerin von Gadamer, ist auch Heideggers Philosophie verpflichtet: sie war lange Vorsitzende der italienischen Heidegger-Gesellschaft. Nach Erscheinen von Heideggers Schwarzen Heften 2014 (in denen sein Antisemitismus unverhohlen zutage trat), legte sie dieses Amt nieder. Sie gehört zu den engagiertesten Intellektuellen in Italien und Europa. Einige Buchtitel:
-
- Heidegger, die Juden, die Shoah, 2016
- Von der politischen Berufung der Philosophie, 2020
- Philosophie der Migration, 2021
- Das Komplott an der Macht, 2022 (über Verschwörungstheorien)
Die Migranten und der Staat (S. 11ff)
Es gibt einen Konflikt zwischen den universellen Menschenrechten und der Aufteilung der Welt in Nationalstaaten. Dieser Konflikt ist nicht lösbar. Es handelt sich um ein konstitutionelles Dilemma. Ein Widerspruch, der für Demokratien besonders schrill ausfällt. Eine Gesellschaft, die eine offene Gesellschaft sein will, schließt ihre Grenzen? Der Migrant enthüllt diesen Konflikt. Er „demaskiert“ den Staat. Allein dadurch, dass er sich bewegt und an der Grenze des Staates ankommt.
Das Wort Staat leitet sich ab von lateinisch status: Stand, Zustand. Es steht also für etwas Stabiles mit einer Art Ewigkeitscharakter – mit dem Schein von Natürlichkeit. Folglich haben seine Grenzen nahezu sakrale, unantastbare Qualität. An der Grenze setzt der Staat um der eigenen Stabilität willen seine souveräne Macht durch. Staat – das Gegenteil von Mobilität.
Die staatszentrierte Ordnung ist als Norm akzeptiert und wird vom internationalen Recht bekräftigt und beglaubigt.
Allg. Erklärung der Menschenrechte 1948, Art. 13
- Jeder Mensch hat das Recht, sich innerhalb eines Staates frei zu bewegen und den Aufenthaltsort frei zu wählen.
- Jeder Mensch hat das Recht, jedes Land, einschließlich des eigenen, zu verlassen und in das eigene Land zurückzukehren.
Das Phänomen der Migration, aus dem Innern des Staates betrachtet, ist etwas Zufälliges, ein marginales Phänomen, eine Anomalie. Das Recht auszuschließen, den Zutritt zum als Eigentum verstandenen Territorium zu verweigern, gilt als selbstverständlich, als Signum staatlicher Souveränität.
Entsprechend wird der Migrant zunächst als gefährlicher Fremder wahrgenommen, als potentieller Feind. Prinzipiell verdächtig. Ihm wird, auch wenn er herein darf, dauerhaft der Prozess gemacht. Du bist nicht von hier, warum bist Du hier? Er muss sein Ankommen, seine Anwesenheit immer neu begründen, rechtfertigen. Statt Gastfreundschaft herrscht Feindseligkeit; beziehungsweise: Gastfreundschaft wird in den Bereich der privaten Moral oder religiöser Verpflichtung abgeschoben, gar als Symptom unbedarften Gutmenschentums verhöhnt – oder gar kriminalisiert.
Jenseits der Souveränität (S. 23ff)
Ein Denkmuster durchzieht das ganze moderne Denken und ist präsent in der Entgegensetzung von Souveränität und Anarchie. Es wurde von Thomas Hobbes eingeführt. Seiner Staatstheorie (Leviathan 1651) zufolge ist die Aufgabe des Staates (des Monarchen): Überwindung des Chaos, des Urzustandes, in welchem der Mensch dem Menschen ein Wolf ist, in dem die Menschen einander bekämpfen (homo homini lupus). Vermittels eines Vertrags unterwerfen sich die Untertanen/Bürger der staatlichen Gewalt. So wird Frieden und Sicherheit hergestellt. Dem entspricht die Dichotomie von Innen und Außen, Ordnung und Anarchie, Sicherheit und Bedrohung.
Aber: Ist das Außen wirklich nur Gewalt und Chaos?
Und weiter: Wenn Staaten Einwanderung einschränken oder ganz verhindern dürfen, legal also, ist es damit auch moralisch-ethisch legitim? Das ist eine philosophische Frage, die außerhalb der Grenzen entspringt, exterritorial, jenseits des Herrschaftsbereichs der Souveränität.
Migration und Philosophie (S. 27ff)
Es gilt zu bedenken: Wer ist der Migrant? Di Cesare will seine Perspektive einnehmen, ihn zum Subjekt zu machen. Bisher hat die Philosophie einen anderen Standpunkt eingenommen: die Sesshaftigkeit – und ihre Perspektive gewählt.
Das Wort Migration ist im Inventar der Philosophie (Wörterbücher etc.) nicht verzeichnet. Es hat hier kein Bürgerrecht. Wie der Fremde ist sie in die Elendsviertel der Metaphysik verbannt. Die Anliegen der Philosophie an der Schwelle zur Moderne waren andere. Es ging ihr darum, Besitzrecht zu begründen, die Aneignung der Erde zu verteidigen und die Aufteilung der Welt in Nationalstaaten rechtfertigen, natürlich unter eurozentrischer Perspektive.
Di Cesare erinnert daran, dass es Hannah Arendt war, die erstmals den Staaten- und Heimatlosen eine Stimme verlieh. Sie bezieht sich auf ihren Artikel Wir Flüchtlinge von 1943. Sie selber war ja zu Flucht und Emigration gezwungen. Nach 1938 emigrierte sie ohne Pass nach Frankreich und dann in die USA, wo sie erst in den 50er Jahren die Staatsbürgerschaft erhielt. Ihre Reflexionen wurden jedoch nicht aufgegriffen und weiter entwickelt.
Stattdessen hinkte die Philosophie in der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts der öffentlichen Meinung hinterher, als die Migration sich als große politische Aufgabe abzeichnete. Sie schloss sich im Urteil Di Cesares einer unreflektierten Meinung an, die der staatszentrierter Optik entsprang.
Alles, auch im philosophischen Diskurs, läuft auf Verwaltung und Disziplinierung der Migrationsbewegungen hinaus.
In Deutschland schrieb die Gesellschaft für Analytische Philosophie Ende 2015 die vielsagende Preisfrage aus: „Welche und wie viele Flüchtlinge sollen wir aufnehmen?“ Als primäres Erfordernis gilt, die Kriterien der Selektion und des Ausschlusses festzulegen. Di Cesare räumt ein, dass Philosophen wie Derrida, Agamben und Levinas Gastfreundschaft thematisierten, ohne sie allerdings als politisches Thema von der Peripherie ins Zentrum zu rücken.
Der Autorin zielt darauf ab, den Migranten als Akteur und Interpreten zu würdigen und die Philosophie als Zeugin seines Schicksals zu etablieren, die die Heimatlosigkeit teilt. Das Denken selber migriert. Hannah Arendt: Denken geschieht stets außer der Ordnung.
Migration und Moderne (S. 39ff)
Ideengeschichtlich lassen sich zwei Paradigmen von Migration ausmachen:
- In der Antike und Vormoderne geschah Ortsveränderung vorwiegend im Kollektiv. So bei Nomaden, militärischen Eroberungen, Invasionen, Abenteuerreisen. Die griechischen Kolonien fungierten als pólis zweiten Grades auf Grund von Ausschluss oder Ausweisung von Unerwünschten, mit denen gleichwohl eine Zusammengehörigkeit anerkannt wurde. Es sollte die bisherige Lebensform in einem Anderswo wiederhergestellt werden. Individuen wie Sokrates und Odysseus können als Ausnahmen betrachtet werden, die die Moderne ankündigen.
- In der Moderne geht Migration einher mit einer neuen Raumauffassung, für die der Globus steht. Die Erde als Kugel erscheint nicht mehr gastfreundlich, bietet keinen Schutz, keinen verlässlichen Innenraum mehr (weder Firmament noch Säulen). Der Prozess der Globalisierung ist die Geschichte einer „Entäußerung“, die Erde ist umgeben vom „Abgrund des Himmels“ (S. 42). Mit der ersten Erdumsegelung geschieht eine Entfremdung. Das Selbst wird aus dem Mittelpunkt verstoßen. Gleichzeitig vollzieht sich aber auch eine Entzauberung, die wie eine Befreiung wirkt. Möglich wird der Traum von einem besseren Leben im Sprung über den Ozean für alle Geknechteten, Verzweifelten, Enttäuschten und Verrückten. Es zeigt sich ein utopischer Charakter der Migration.
a
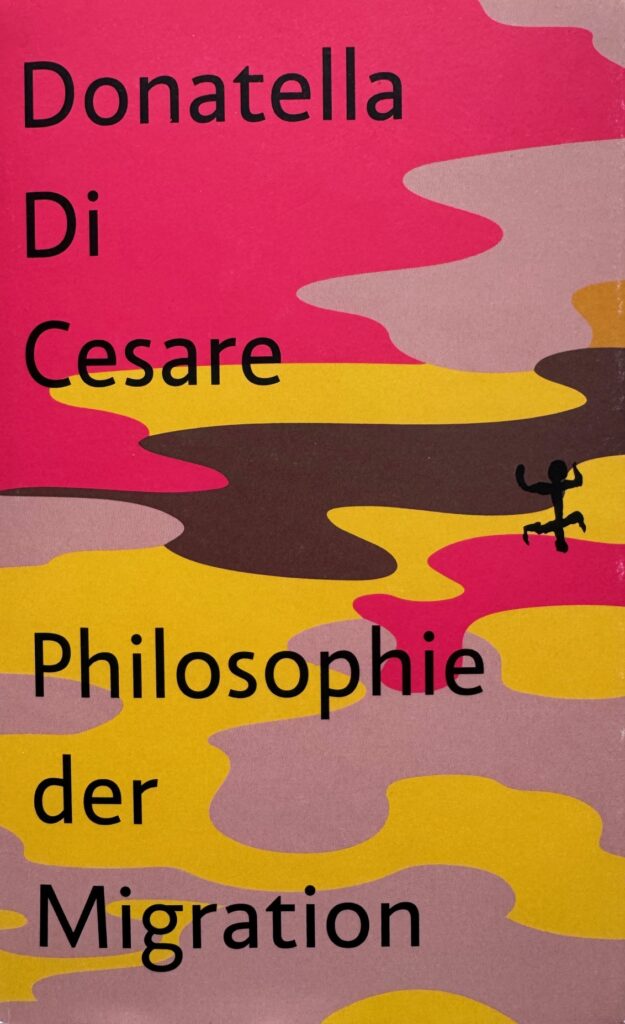
2017 in Italien erschienen: Stranieri Residenti
2021 Dt. Übers. im Verlag Matthes & Seitz
Wir Flüchtlinge (S. 44ff)
Hannah Arendt dachte als erste über Migration als globales Phänomen nach, als Massenphänomen. Der Aufstieg der Nationalstaaten im 19. Jhdt. und der Zerfall der großen Imperien nach dem 1. Weltkrieg brachte den Flüchtling als Ausnahmegestalt hervor. Er ist fehl am Platz in der territorialen Ordnung der Nationalstaaten.
„Wen immer die Verfolger als Auswurf der Menschheit aus dem Lande jagten – Juden, Trotzkisten und so weiter –, wurde überall auch als Auswurf der Menschheit empfangen“ (Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, S. 598).
Jeder Krieg, jede Revolution brachte neue Staatenlose hervor, so auch die Nazidiktatur.
Di Cesare zitiert Arendt (S. 52):
Historisch beispiellos ist nicht der Verlust der Heimat, wohl aber die Unmöglichkeit, eine neue zu finden. Jählings gab es auf der Erde keinen Platz mehr, wohin Wanderer gehen konnten, ohne den schärfsten Einschränkungen unterworfen zu sein, kein Land, das sie assimilierte, kein Territorium, auf dem sie eine neue Gemeinschaft errichten konnten. Dabei hatte diese Unmöglichkeit keineswegs ihren Grund in Bevölkerungsproblemen; menschenleere Länder benahmen sich nicht anders als übervölkerte; es war kein Raumproblem, sondern eine Frage politischer Organisation. Was sich herausstellte, war, daß das Menschengeschlecht, das man sich so lange unter dem Bilde einer Familie von Nationen vorgestellt hatte, dieses Stadium wirklich erreicht hatte – mit dem Resultat, daß jeder, der aus einer dieser geschlossenen politischen Gemeinschaften ausgeschlossen wurde, sich aus der gesamten Familie der Nationen und damit aus der Menschheit selbst ausgeschlossen fand. (Arendt: Elemente S. 636f)
Zwar gilt der Assimilierte in seinem unendlichen Bemühen, sich zu integrieren, ein guter Patriot zu werden, als der ideale Einwanderer. Jedoch helfen all seine Anstrengungen nicht. Er bleibt verdächtig. Und der Staatenlose ist per definitionem illegal. Ohne Bewilligung in einem Gebiet ansässig zu sein, wird zu einem Verbrechen.
Dabei gibt es keine wesentlichen Unterschiede zwischen totalitären und demokratischen Staaten. Das Entscheidende ist das Konzept der Nation, nicht die Staatsform. Das Wort Nation kommt von nasci – geboren werden.
Die Zugehörigkeit qua Geburt, Pass, Ethnie gibt den Ausschlag.
Die Konsequenz für Menschen- und Bürgerrechte: Wer nur die nackte Menschlichkeit vorzuweisen hat, hat keine Rechte. Es fehlt an einer kosmopolitischen Instanz, die für die Menschenrechte einstehen könnte. Das „Recht, Rechte zu haben“ (Arendt, Elemente S. 643) hatten Millionen Menschen verloren, gerade weil es keinen „unzivilisierten“ Flecken Erde mehr gibt. So wird der Verlust der Heimat und des politischen Status identisch mit der Ausstoßung aus der Menschheit überhaupt. Ihr Status ist schlechter als der eines Verbrechers.
Die Grenze der Demokratie – Demokratie und Grenze (S. 56ff)
Auch Demokratien bieten keinen Schutz vor der beschriebenen Ausstoßung.
Auch ihre Grenzen bedeuten zugleich Schutz und Diskriminierung, schließen ein und aus. Die demokratische Inklusion erweist sich als undemokratische Exklusion. Ihre Rechtmäßigkeit wird nicht mehr überprüft.
Die Demokratie legitimiert sich durch zwei philosophische Quellen:
- Durch Jean Jaques Rousseaus Volkssouveränität, die Selbstgesetzgebung, den „Gemeinwillen“. Das Volk, der Demos ist der Gesetzgeber. Auch für Kant gilt: Das Volk ist Subjekt und Objekt der von ihm erlassenen Gesetze. Natürlich stellt sich die Frage, was mit den individuellen Rechten geschieht. Der Konflikt zwischen Gemeinwillen und Partikularinteressen bleibt bestehen.
- Durch den Liberalismus und seinen Akzent auf individuellen Rechten. Die Demokratie wird zum Terrain eines vertraglichen Disputs: jede Person macht eigene Rechte und Interessen geltend. Die Demokratie gibt Rahmenbedingungen vor für die freie Aushandlung. Sie selbst gibt sich neutral und damit legitim. Für Di Cesare ist dies eine Fiktion. Was ist mit den Schwächsten und mit den Minderheiten? Auch im liberalen Konzept werden Freiheit und Gleichheit nur im Innern geschützt. Grenzüberschreitende Bewegungsfreiheit wird nicht thematisiert.
Di Cesare setzt sich mit Vertretern liberaler Theorien auseinander, die auf den individuellen Rechten bestehen und gleichwohl die souveränistische Perspektive beibehalten. Dazu gehört etwa der amerikanische Philosoph Michael Walzer (S. 60ff). In seinem Buch „Sphären der Gerechtigkeit“ entwickelt er Leitlinien und Legitimation für eine Politik des Ausschlusses und des Schutzes vor Einwanderung aus souveränistischer Perspektive. Er betrachtet die Gemeinschaft, die geteilte Welt von Sprache, Geschichte und Kultur als das wichtigste Gut. Membership gilt als tragende Säule. Über sie wird von innen entschieden. Fremde sind „Bewerber“, über deren Zulassung die Mitglieder entscheiden. Die Grenze zwischen Bürger und Fremdem wird in Einzelfällen durchlässig. Hilfeleistung ist möglich, falls sie ohne Risiko geschieht. Gastfreundschaft und Fürsorge bleiben zeitlich begrenzt.
Die Gemeinschaft/der Staat ist also wie ein Verein, dessen Gründungsmitglieder über Neuzugänge entscheiden. Was soll ihr Kriterium sein? Soll die ethnische Verwandtschaft zählen? So wie wir möglicherweise die Ukraine mehr unterstützen als Senegal? Nach diesem Kriterium kam es zwischen Türken und Griechen 1923 zum Bevölkerungsaustausch. Hier ist schnell von Geburt, Blut und Abstammung die Rede, wie es ja Carl Schmitt wollte: Ausscheidung und Vernichtung des Heterogenen. Nach Walzer gründet sich der Nationalstaat und damit die nationale Identität sowohl auf die Abstammung (Blut) als auch auf das Territorium. Über die Zulassung von Zuwanderern entscheiden diejenigen, „die sich bereits an Ort und Stelle befinden“ (Zitat von Michael Walzer: Sphären der Gerechtigkeit, Campus Verlag 1994, S. 81) Der Vorrang von Sesshaftigkeit vor Mobilität wird nicht begründet.
Di Cesares Kritik und Zurückweisung der Position Schmitts stützt sich auf drei Argumente (S. 69ff):
- Die Theorien von Hobbes und Rousseau begründeten den Beginn einer Staatsmacht auf einem fiktiven Vertrag. „Als käme die Verpflichtung dem andern gegenüber nicht jedem Vertrag zuvor.“ (S. 75)
Einerseits insistieren die Vertragstheoretiker auf der individuellen Freiheit der Mitglieder, andererseits gilt genau dieses höchste Gut der Freiheit nicht für die Fremden. - Identitäre, nationale Integrität
Die Betonung auf dem Schutz der Gemeinschaft schürt die Angst vor Bedrohung und Kontaminierung. Die Nation im vorpolitischen Sinne ist zu unterscheiden von der Staatsbürgerschaft. Mit Jürgen Habermas gilt es, die Staatsbürgerschaft von einer nationalen Identität zu entkoppeln. „Der Anwärter auf Staatsbürgerschaft ist daher nicht verpflichtet, zum Mitglied einer – im Übrigen zum Großteil fiktiven, auf Mythen basierenden und sakralisierten – nationalen Gemeinschaft zu werden.“ (S. 76) Was man vom neuen Bürger verlangen kann, ist das Teilen der demokratischen politischen Kultur unabhängig von seinen mitgebrachten Kultur- und Lebensformen. - Territoriales Eigentum/Besitz des Bodens
Die Berufung Das ist unser Land! ist fehlgeleitet. Der Boden als Privatbesitz der Staatsbürger ist ein Mythos. Di Cesare verweist (S. 78) auf Kants Schrift Zum ewigen Frieden, in der es heißt: „ursprünglich aber niemand an einem Orte der Erde zu sein mehr Rechte hat, als der andere“. Kant gesteht allerdings zu, der Fremdling könne abgewiesen werden, aber er dürfe „nicht feindselig behandelt“ werden. Er habe zwar kein „Gastrecht, aber ein Besuchsrecht, welches allen Menschen zusteht, sich zur Gesellschaft anzubieten“. Damit schränkt Kant das „Weltbürgerrecht“ „auf Bedingungen der allgemeinen Hospitalität“ ein. In der traditionellen politischen Philosophie hatte John Locke die Frage: Wie gelangt man zum Privatbesitz? angesichts der Tatsache, dass Gott „die Welt den Menschen gemeinsam übertragen hat“ so beantwortet: durch Arbeit, Bearbeiten, Kultivieren (Zwei Abhandlungen über die Regierung, 1690). Lateinisch colere bedeutet: pflegen, bestellen, kultivieren. Von diesem Wort leiten sich Kultur und Kolonie ab.
Der Boden wird der ursprünglichen Gemeinschaftlichkeit entzogen, nach Locke zu Recht, denn die Arbeit fügt ihm etwas hinzu. Er erfährt eine Wertsteigerung. Was individuell gilt, gelte auch für den Staat. Weder ein Vertrag noch die Einwilligung konkurrierender Interessenten oder von Anwohnern sei notwendig, weil auch reichlich Land als Allgemeingut (noch) zur Verfügung steht (stand).
Kant berücksichtigt stärker die Begrenztheit der Flächen (Metaphysik der Sitten § 62) wegen der Kugelgestalt der Erde. Er betont die Notwendigkeit, einander zu dulden. Ein Besitz von Boden kann immer nur gedacht werden „als Besitz von einem Teil eines bestimmten Ganzen, folglich als ein solcher, auf den jeder derselben ursprünglich ein Recht hat“. Völlig unrechtmäßig ist eine Inbesitznahme von Boden gegen den Willen der dort Lebenden. Es ginge nur durch einen Vertrag, der aber nicht „mit Benutzung der Unwissenheit jener Anwohner“ geschehen dürfe. Kant vergisst auch nicht zu betonen, dass Hirten- und Jagdvölker von „großen öden Landstrecken“ abhängen.
a
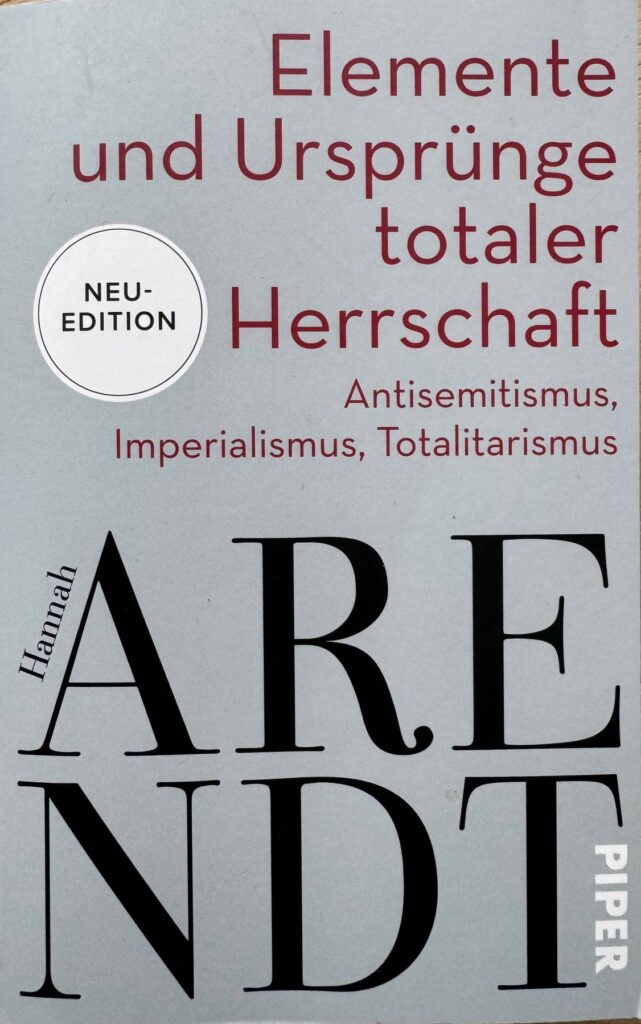
Erweiterte Neuausgabe
Pieper Verlag 1986, 2023
Bewegungsfreiheit und das Privileg der Geburt (S. 84ff)
Bewegungsfreiheit ist als fundamentales Recht des Individuums zu betrachten. Warum sollte der Staat es beschränken dürfen?
Hier ist eine Trennung zwischen souveränistischen Liberalen, die „stärker darauf bedacht [sind], die staatszentrierte Ordnung zu bewahren“ und weltbürgerlichen Liberalen, die tendenziell „für die Abschaffung der Grenzen eintreten“ zu konstatieren.
So plädiert Joseph Carens (Fremde und Bürger, 1987) gegen Michael Walzer für offene Grenzen und verteidigt die Freiheit des Individuums gegen den Staat.
Drei Argumente sind hier zu nennen: Bewegungsfreiheit, egalitäre Güterverteilung, Gemeinschaftlichkeit des Bodens
Offene Grenzen
„Die Staatsbürgerschaft in einer liberalen Demokratie des Westens ist das moderne Äquivalent feudaler Privilegien“ so zitiert Di Cesare Joseph Carens.
„Wer verleiht das Recht, die Waffen auf diejenigen zu richten, die Grenzen überschreiten wollen? Diese Gewalt könnte gerechtfertigt werden, wenn es sich um Kriminelle, ihrerseits bewaffnete Invasoren und Staatsfeinde handelte.“ Der Egalitarismus, der den Einzelnen gegenüber der Gemeinschaft schützt, fügt sich nach Di Cesare „perfekt in die liberale Tradition ein.“ (S. 87) Robert Nozicks Idee des Minimalstaates würde gut dazu passen. Auch das Gedankenexperiment von John Rawls, das in dem Versuch besteht, Prinzipien der Gerechtigkeit zu finden, auf die man sich einigen könnte, noch nicht wissend, welchen Platz in der Gesellschaft man einnehmen wird, könnte erweitert werden um das Recht auf freien Verkehr und Zugangsrecht zu jedem Land.
Di Cesare kritisiert jedoch diesen Egalitarismus, weil er der Wirklichkeit Hohn spricht: Als wäre jedes ökonomische, politische oder soziale Problem allein auf einen Mangel an Freiheit zurückzuführen. Es ist illusorisch, von einer idealen Symmetrie zwischen gleichen und freien Individuen auszugehen, als „wäre der ankommende Migrant ein neuer Geschäftspartner, der seine Beteiligung ebenbürtig aushandeln könnte…“. Damit wird die „Komplexität des Migrationsphänomens auf die gewöhnliche Banalität freien Verkehrs“ herabgesetzt (S. 90).
Migranten gegen Arme? Wohlstandschauvinismus und globale Gerechtigkeit (S. 91ff)
Gegen das Recht auf Bewegungsfreiheit werden diverse wirtschaftliche Argumente ins Feld geführt: die Destabilisierung des Sozialstaats, die Aufnahme gehe auf Kosten der Einheimischen (Migranten nehmen Arbeit weg, kassieren Sozialhilfe oder andere Unterstützung, lassen sich die Zähne machen etc.). Darin greift die immunitäre Logik des Wir zuerst. In Dänemark wurde 2016 ein Gesetz beschlossen, nach dem der Schmuck von Einwanderern beschlagnahmt wird zur Finanzierung von Sozialleistungen (S. 92f).
Di Cesare zitiert einige Stimmen von Philosophen: Nida-Rümelin etwa meint, es gelte einen brain drain in den Auswanderungsländern zu verhindern. Es solle diesen Ländern vielmehr mit gezielten Programmen geholfen werden.
Habermas meint kein individuelles Recht auf Einwanderung zugestehen zu können, sieht aber eine moralische Verpflichtung Europas zu einer liberalen Einwanderungspolitik, die nicht allein auf die eigenen „wirtschaftlichen Bedürfnisse“ ausgerichtet ist. Seinen „Widerspruch gegen den Wohlstandschauvinismus“ teilt Di Cesare. Neuankömmlinge werden meist nur unter wirtschaftlichen und Nützlichkeitsgesichtspunkten gesehen: als Arbeiter erwünscht, als Fremder unerwünscht, wanted but not welcome.
Das ius migrandi bleibt eine der großen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts. Das Projekt einer weltweiten governance wird von der UNO seit 2007 im Global Forum on Migration and Development vorangetrieben. Das lateinische migrare meint nicht bloß sich bewegen, sondern darin auch mutare, und verweist damit auf einen komplexen Wechsel und Tausch.
Kant: das Besuchsrecht und der verweigerte Wohnsitz (S. 110ff)
Die Genfer Flüchtlings-Konvention von 1951 bezieht sich mit ihrem Non-Refoulement-Prinzip, dem Grundsatz der Nichtzurückweisung auf Kant. Der erste Eintritt darf dem Fremden nicht verweigert werden, „»wenn dies nicht ohne seinen Untergang«, ohne dabei sein Leben aufs Spiel zu setzen geschehen kann.“ (S.110) Das Mittelmeer allerdings und der Friedhof von Lampedusa erzählen die Geschichten des Untergangs.
Das Weltbürgerrecht auf allgemeine Hospitalität stellt für Kant die Bedingung des ewigen Friedens dar, das die Kategorien des Kriegsrechts ablösen soll.
Ansässige Fremde (S. 183ff)
Die Autorin bringt zwei Modelle ins Spiel für eine nicht staatszentrierte Philosophie der Migration, Modelle, die eine andere Art des Zusammenwohnens erschließen; in einer Gemeinschaft, die sich nicht über ihre Grenzen definiert und abschließt.
Sie knüpft an 1. an Heideggers Aufsatz Bauen Wohnen Denken aus dem Jahr 1951 an und blickt zurück auf die Philosophie Platons über den Wohnort Athen,
und zweitens 2. an das Recht der Tora, das Modell der Stadt, wie es sich in der hebräischen Bibel findet.
- Philosophie des Wohnens (S. 188ff)
1.1 Heidegger
In Anlehnung an Heideggers Philosophie skizziert sie eine Phänomenologie des Wohnens. Sie konstatiert zunächst eine Diasporisierung der Welt im neuen Jahrtausend: das Selbst ist an keinem Ort mehr zu Hause. Das jüdische Exil ist der Präzedenzfall. Die Bedingung des Exils, der Entwurzelung wird zur Norm. Der schutzlose Fremde entsetzt, weil er den Kern einer jeden Existenz freilegt.
Das Paradox besteht darin, überall zu Hause sein können und es nirgends zu sein. Neu ist eine Kommunikationstechnologie, die eine fortschreitende Beseitigung alles Fremden darstellt. Dazu tragen auch der Tourismus, die Warenströme und die Arbeitskraft bei, die alle über Grenzen hinweg zirkulieren.
Wohnen/habitare ist der Frequentativ von habere und meint also: etwas dauerhaft und gewohnheitsmäßig haben.
Im Deutschen meint wohnen, das von wunian abstammt, zu tun pflegen, in Besitz und Zugehörigkeit bleiben. Bleiben führt zu Besitzen, zum Eigentumsrecht. Ort und Selbst verstärken sich gegenseitig.
Es ist sehr schwer, Wohnen und Haben zu entkoppeln und sich dem Sein anzunähern. Heidegger versucht das Wohnen mit dem Sein zu verbinden, das Wohnen in die Existenz einzuschreiben, daraus ein Existential zu machen. So in Sein und Zeit § 12. Nach der traditionellen Metaphysik bedeutet Existenz „was wirklich und einfach anwesend ist“ (S. 190). Heidegger aber deutet Existenz, das Dassein, In-der-Welt-Sein dynamisch: ek-sistere, heraustreten, auftauchen. Nicht wie in einem Behältnis, an einem Ort, sondern es vollzieht sich als Beziehung, es eröffnet Welt. Er zieht den radikalen Schluss: Welt wird nur, wo das Dasein (der Mensch!) existiert.
Heideggers Philosophie des Wohnens kreist um das Thema des Aufenthalts, des vorübergehenden Weilens und flüchtigen Bleibens auf der Erde. „Die Sterblichen müssen das Wohnen erst lernen.“ Transitivität, also Übergänge und Vergänglichkeit zeichnen ihr Bleiben aus. Aus unbedingtem Bleibenwollen folgt Erstarrung, Bedrohung des Anderen.
Existenz meint dagegen: Beständiges Aus-sich-heraustreten und Abtrennung von sich selbst. Wohnen heißt letztlich Migrieren, den Aufenthalt auf einer Reise. Heidegger spricht von Wanderung, eine Bewegung, die immer auch eine Auseinandersetzung mit dem Anderen ist. Wohnen als Wandern verweist auf das Strömen eines Flusses. In diesem Fließen ist das bei-sich-sein paradoxerweise immer schon ein Außer-sich-sein. Bedeutsam ist der Wechsel des Elements in dieser Sichtweise: Wasser statt Erde, keine Legitimation in Blut und Boden. „Der Strom reißt jede Besitzurkunde, jeden Erbanspruch mit sich fort.“
Migrieren – wohin?
Das Ziel wird sein, eine Heimat zu gewinnen. Der Weg dorthin besteht im Heimischwerden im Unheimischen. Die Sehnsucht und das Wagnis kennzeichnen die Migration. Heimat entzieht sich aber fortwährend, bleibt ein Anderswo, dem man sich nur annähern kann.
Im Anschluss an Heidegger benennt Di Cesare sowohl die Täuschung und Illusion des Sesshaften, der meint in einer sicheren Zugehörigkeit schon zu Hause zu sein, als auch die Täuschung der Entwurzelung, die „weder Kurs noch Ziel oder Heimkehr kennt“ und „aus dem modernen Menschen einen »planetarischen Abenteurer« macht“ (S. 197).
1.2 Athen: Die »Söhne der Erde« und der Mythos der Autochthonie (S. 199ff)
Ein Blick in die Antike und in Platons politische Schriften: Der Staatsmann und Menexenos behandeln den Gründungsmythos der Stadt Athen; also die Erzählung und Legende, die dazu dient den exklusiven Besitz des Stadtgebiets zu untermauern. Warum gehört dieses Territorium ausschließlich uns, den Stadtbürgern? Das gilt es zu begründen.
Die mythische Reinheit der Vergangenheit rechtfertigt das Eigentumsrecht für die Gegenwart. Der Besitzanspruch der Gegenwart reicht also in Uranfänge zurück. (Im Gegensatz zu Athen ist Sparta die Stadt der Einwanderer.)
Die Reinheit der Abstammung ist für die Bewohner unverzichtbar. Plato spricht von eughéneia (die gute Geburt/Wohlgeborenheit). Dabei gilt das väterliche Abstammungsprinzip. Patria ist das Vaterland. Folgerichtig sind von den Bürgerrechten ausgeschlossen die Frauen, aber auch Adoptivkinder, uneheliche Söhne, Einwanderer und die Metöken, die Fremden in der Stadt, die zugezogen sind. Sie wohnen am selben Ort, haben aber keinen Anteil an der Gemeinschaft.
Auf dieser Grundlage ist die athenische Demokratie zu verstehen. Gleichheit wird nicht angestrebt, sondern (unter den Bürgern) vorausgesetzt. Die Bedingung ist: genetische Einheit, Homogenität, Gleichgebürtigkeit. So erklärt sich Athen zum authentischen Griechenland, nicht kontaminiert, verunreinigt durch fremde Einflüsse, durch fremdes Blut. Es grenzt sich gegen die Barbaren ab. Di Cesare zitiert Herodot, der von den Athenern sagt, sie seien der „einzige Hellenenstamm, der nie andere Wohnsitze aufgesucht hat“ (S. 205). Der Rest der Griechen, „die an die Grenzen zur barbarischen Welt gedrängt werden“, sind als „Unreine oder Halbbarbaren“ anzusehen.
Und in Platos Menexenos (245d) heißt es: „Daher ist der Stadt ein ganz reiner Hass eingegossen gegen fremde Natur.“ (S. 205) De Cesare nennt das den athenischen „Imperialismus der Selbigkeit“.
Das Prinzip der Autochthonie bedeutet, dass das Selbst (autos) oder das Eigene eine unauflösliche Einheit mit dem Boden (chthon) bildet. Die Prinzipien von Blut und Boden also schließen die Bürger stabil zusammen und schließen zugleich die andern aus.
Di Cesare sieht diese Prinzipien bis heute wirksam in Denkmustern und emotionalen Reflexen, in den Gespenstern von Blut und Boden.
- Die theologisch-politische Charta des ger (S. 216ff)
Das alternative Modell, in dem ein Zusammenwohnen der Verschiedenen, der Einheimischen und der (ansässigen) Fremden bedacht wird und durch Recht geregelt wird, findet Di Cesare in der biblischen Tradition, in der hebräischen Landschaft. In der Tora konstatiert sie als eine Hauptfigur den Fremden, hebräisch ger im Unterschied zum aezrach, dem Einheimischen.
Wieder geht sie auf die Etymologie ein. ger vom Verb gur/wohnen bezeichnet gleichzeitig Wohnen wie auch Fremdheit, zwei Begriffe, die sich aus griechischer Sicht gegenseitig ausschließen und der Logik der Autochthonie total zuwider laufen. ger ist derjenige, der wohnt, wiewohl er von außerhalb kommt. Er verbindet sich als Gast oder Proselyt mit Israel. Das Fremdsein und das Wohnen, in einem Wort kurzgeschlossen, modifizieren sich gegenseitig. Der Fremde ist ein Wohnender, der Einheimische ist auch fremd.
Di Cesare unternimmt eine komplexe Meditation (S. 219). Sie legt die Leere im Kern aller Identität frei, welche von ersterer in Bewegung gehalten wird. Der Fremde erinnert den Einwohner daran, selbst ein Fremder zu sein. ger verweist den Hebräer auf seine eigene Vergangenheit.
Ja, der Ger tritt in die Gemeinschaft des Bundes, des Rechts ein. Exodus 12, 49 heißt es: Ein und dasselbe Gesetz gelte für den Einheimischen und den Fremdling, der unter euch wohnt.
Darüber hinaus existiert eine regelrechte Charta des „ansässigen Fremden“ (von Buber und Rosenzweig übrigens treffend als Gastsasse übersetzt). Dem ger gilt ein besonderer Schutz: Den Fremdling sollst du nicht bedrängen und bedrücken, denn ihr seid auch Fremdlinge in Ägypten gewesen. (Exodus 22, 20) Auch der ger darf am Schabbat ruhen. Du sollst ihn lieben wie dich selbst. (Leviticus 19, 34)
Woher aber kam der ger? Di Cesare erinnert an die Fremden, die mit Israel aus Ägypten gezogen waren, das viele fremde Volk (Exodus 12, 38).
„Die Anwesenheit der gerim verleiht dem Exodus eine universale Bedeutung.“ (S. 226) „Von jenem Augenblick an wusste ein jeder, dass er kein Sklave mehr sein musste.“ (ebd.)
Jerusalem: Die Stadt der Fremden (S. 223ff)
Di Cesare erinnert an Rut, die Moabiterin als Archetyp der Fremden, uneheliche Tochter einer unehelichen Tochter, „eine Ausgeschlossene unter den Ausgeschlossenen“. Gerade sie wird zur Mutter des Königtums. Von ihr leitet sich die davidisch-messianische Dynastie her. Diese Betrachtung gipfelt in dem Resümee „In der biblischen Stadt regiert die Fremdheit souverän.“ (S. 224)
Das zugrundeliegende Muster für die biblische Stadt ist das Lager in der Wüste. In dieser wurde es jeweils errichtet um die Stiftshütte herum, das Zelt der Begegnung. „Hier haben weder Geschlossenheit oder Vollständigkeit noch Autochthonie einen Platz. Die Fremdheit bildet den Grund und das Fundament von Gemeinschaft.“ (S. 225)
„Der politischen Verfassung der Thora zufolge sind alle Bürger Fremde und alle Bewohner Gäste. Der Begriff der Gastfreundschaft weitet und vertieft sich, bis er schließlich mit dem der Bürgerschaft übereinstimmt.“ (S. 230 ) Ihre Grundlage ist nicht Eigentum, Besitz des Bodens. Dies wird ausdrücklich zurückgewiesen in der Gesetzgebung am Sinai: „Darum sollt ihr das Land nicht verkaufen für immer; denn das Land ist mein, und ihr seid Fremdlinge und Beisassen bei mir.“ (Leviticus 25, 23) (Beisasse, ger tôŝāb, ansässiger Fremder, zeitweiliger Ansässiger, Gast). Selbst Gast zu sein macht Gastfreundschaft zur (politischen) Pflicht. Es erhebt das Asyl zu einer nicht länger nur theologischen, sondern ebenso existentiellen wie politischen Kategorie.
Mit ihrem Buch will Di Cesare die Forderung nach einem ius migrandi konzeptionell unterfüttern, und stärken. Zu diesem Recht gehöre eben nicht nur das Recht auszuwandern, sondern auch anzukommen, auch die Aufnahme, d. h. Gastfreundschaft. Ihr Plädoyer für das ius migrandi stellt ein anderes (vermeintliches) Recht in Frage: das angemaßte Recht, darüber zu entscheiden, mit wem man zusammenwohnen will: das „Recht“ der Selektion.
Was heißt Zusammenwohnen? (S. 235ff)
Aufnahme: es genügt, sich ein wenig zu dezentrieren, den Anderen etwas Platz zu machen: so eröffnen sich neue Räume.
Am Ende erinnert Di Cesare noch einmal an Hannah Arendt. In der Schlusspassage ihres Berichts über die Banalität des Bösen (Eichmann in Jerusalem) erhebt sie politische Anklage gegen Eichmann, den Organisator der Shoah. An ihn gerichtet fordert sie die Todesstrafe für ihn:
„Sie [haben] eine Politik gefördert und mitverwirklicht …, in der sich der Wille kundtat, die Erde nicht mit dem jüdischen Volk und einer Reihe anderer Volksgruppen zu teilen, als ob Sie und ihre Vorgesetzten das Recht gehabt hätten, zu entscheiden, wer die Erde bewohnen soll und wer nicht. Keinem Angehörigen des Menschengeschlechts kann zugemutet werden, mit denen, die solches wollen und in die Tat umsetzen, die Erde zusammen zu bewohnen. Dies ist der Grund, der einzige Grund, dass Sie sterben müssen.“ (S. 295, Hannah Arendt: Eichmann in Jerusalem, Pieper Verlag, erw. Taschenbuchausgabe 1986, S. 404)
Arendt konstatiert einen roten Faden, der von Diskriminierung über Vertreibung, Ausschluss, Deportation bis hin zur Internierung in Konzentrationslager und Vernichtungslager führt.
Ebendies macht das Verbrechen so ungeheuerlich: der Anspruch festlegen zu können, mit wem man zusammenwohnen will, die Logik der Selektion.
Zuvor hatte Arendt geschrieben, der Raub der Menschenrechte finde dadurch statt, dass „der Mensch den Standort in der Welt verliert, durch den er überhaupt Rechte haben kann.“ (Elemente und Ursprünge S.642)
Mit Arendt und über Arendt hinaus betont di Cesare,
„dass das wechselseitige gemeinschaftliche Band jedweder Vereinbarung und jedem willentlichen Akt vorausgeht“. „Ungewollte Nähe und nicht gewähltes Zusammenwohnen bilden die Vorbedingungen der politischen Existenz.“ (S. 298) „In diesem Sinne geht das Zusammenwohnen, jenes am Grund jeden gemeinschaftlichen Bandes befindliche Mit-Sein, das die menschliche Existenz kennzeichnet, jeder politischen Entscheidung voraus.“ (S. 299)
Der ansässige Fremde (der fremd bleiben darf, sich nicht assimilieren, naturalisieren, integrieren muss), verweist auf das unvordenkliche Exil eines jeden. Er erinnert sich selbst und die anderen daran, dass auf der „nicht anzueignenden und unveräußerlichen Erde ein jeder nur zeitweiliger Gast und Bewohner ist.“ (S. 304) Di Cesare schließt mit diesem utopischen visionären Akzent. Der Fremde zeugt von der Möglichkeit eines andren Wohnens, einer anderen Weise des In-der-Welt-Seins, einer anderen Weltordnung.
Resümee
Allein wegen der literarischen Qualität ist die Lektüre des Textes lohnend und eine Freude.
Wertvoll macht dieses Buch, dass es die Sicht auf Migration grundlegend verändert, die Perspektive des/der Fremden einnimmt, aber auch den Blick derer, die über Fremde reden, zurückwendet auf sie selbst, eine Re-flexion im Wortsinn, vielleicht auch einem existentiellen Sinn.
So könnte es mit seinem radikalen Ansatz ein bedeutender Impuls für die Ethik der Menschenrechte und die Anthropologie überhaupt sein. „Ich stelle die Souveränität des Subjekts selbst infrage. Es ist Zeit, dem Selbst endlich … den Vorrang zu entziehen. Vor dem Selbst kommt der Andere, dem es zu antworten gilt. … Die Menschenwürde ist die Würde des Fremden“ – so die Autorin im Gespräch mit der ZEIT und dem weiteren Gesprächspartner Omri Boehm (DIE ZEIT Nr. 34/2023).
Sternstunde Philosophie SRF 7.11.2021 Donatella Di Cesare, Für eine neue Gastfreundschaft
Anmerkungen
[*] Die Autorin war bis 2021 Pfarrerin in Stuttgart. Sie referierte über das Buch von Di Cesare im Ethischen Café des Bildungszentrums Hospitalhof Stuttgart am 25. Oktober 2023.
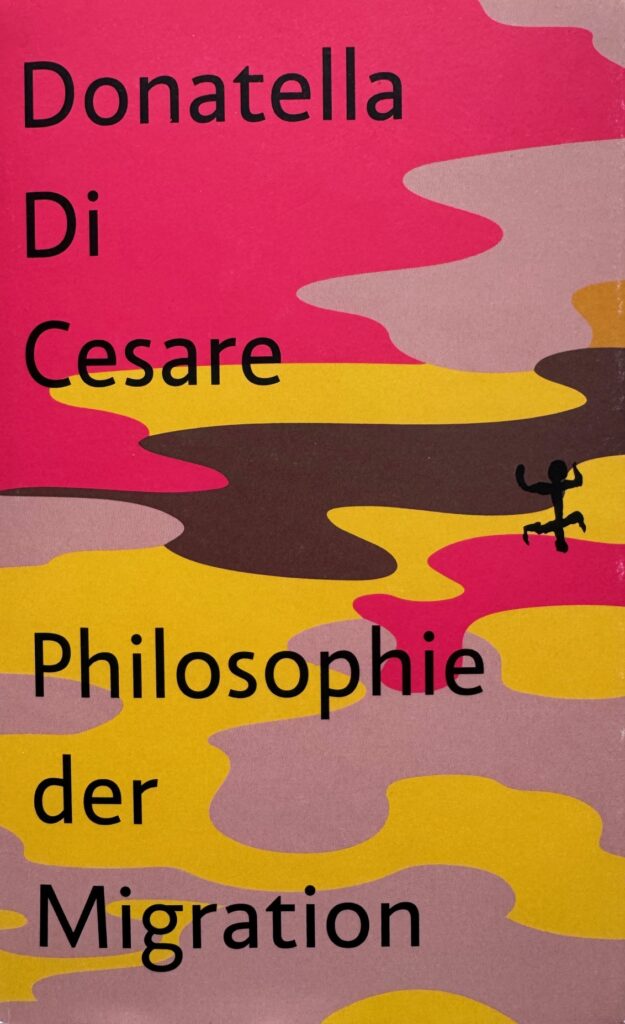
2017 in Italien erschienen: Stranieri Residenti
2021 Dt. Übers. im Verlag Matthes & Seitz




Hinterlasse einen Kommentar