Welt in Aufruhr
Der Titel Welt in Aufruhr scheint eine aufregende Analyse der gegenwärtigen Krisen zu versprechen. Was Münkler aber liefert, ist eine Darstellung von Typologien von Weltordnungen, Machtstrukturen und geopolitische Strategien von Thukydides bis Carl Schmitt.
Was führte zum Krieg gegen die Ukraine?
Natürlich kommen bei Münkler recht bald die Ursachen für den Krieg in der Ukraine zur Sprache.
Erhellend ist die Gegenüberstellung der beiden Narrative bezüglich der initiativen Akteure: Ist hier Russland zu nennen und die Linie zu ziehen von den beiden Tschetschenienkriegen über den Georgienkrieg bis hin zur Annexion der Krim? Oder beginnt man mit den NATO-Luftangriffen auf Serbien im Jahr 1999 und dem dritten Golfkrieg der USA? Je nachdem, worauf der Fokus der Aufmerksamkeit gerichtet ist, erfolgen üblicherweise auch die entsprechenden Schuldzuweisungen.
Nach Münkler wurden jedenfalls die NATO-Angriffe von 1999 auf das überwiegend orthodoxe Serbien von Russland „als eine schwere Demütigung empfunden“. Die Legitimierung der westlichen Luftschläge zum Schutz einer ethnischen Minderheit „avancierte zur russischen Begründung für militärisches Eingreifen von Georgien über die Krim bis zum Donbas: Auch hier war durchweg vom Schutz der russischen Minderheit die Rede.“ (S. 40)
Nach Äußerungen Putins könnte man annehmen, dass er einen NATO-Beitritt der Ukraine verhindern wollte. Aber:
Einer anderen Sicht zufolge ist Russland „nicht von der NATO und ihren Raketen eingekreist worden, sondern von der Idee der Demokratie, der Menschenrechte, des Rechtsstaats, der individuellen Freiheit und vor allem dem Wunsch nach einem besseren Leben.“ (S. 92)
Diese Deutung macht „verständlich“, warum es „Russland in diesem Krieg nicht nur um die Zerschlagung der politischen Strukturen der Ukraine, „sondern auch um eine möglichst umfassende Zerstörung des Landes, seiner Infrastruktur, der Fabriken sowie der exportorientierten Landwirtschaft“ geht (S. 91). Auch wenn Münkler hier einen Erklärungsansatz referiert, irritiert doch, dass er häufig von Russland spricht, während er richtiger von Putin sprechen sollte. Gerade sein eigener Erklärungsansatz setzt diese Differenzierung geradezu voraus, weshalb Münkler dann doch konkret „die Herren im Kreml“ nennt:
„Es ging und geht darum, an den Grenzen des real existierenden Russland ein alternatives Russland zu verhindern, das eine für die Herren im Kreml gefährliche Attraktivität gewinnen könnte. Folgt man dieser Erklärung, so war mehr als ein NATO-Beitritt der Ukraine, deren EU-Mitgliedschaft die für die russische Politik ausschlaggebende Herausforderung…“. (S. 91)
Die interessanten Ausführungen zur Ukraine entsprechen den durch den Titel geweckten Erwartungen.
Welt in Aufruhr?
Nun hätte ich erwartet, dass auch andere brisante Themen erörtert werden, wie die Migrationsthematik oder die sich verschärfenden Folgen der Klimakrise, die populistischen Dynamiken oder die Verschwörungserzählungen, die auch durch die Coronapandemie an Relevanz und Brisanz gewonnen haben.
Jedoch: Zu all diesen Themen findet sich so gut wie nichts.
Münkler verfolgt in seiner Darstellung also nicht einzelne Problembereiche, sondern folgt Typologien und systematisierenden Modellen, die er durch Beispiele anreichert. Er spricht selbst von einer „modelltheoretischen Sicht“ (z.B. S. 428). Der Titel weckte andere Erwartungen.
blind
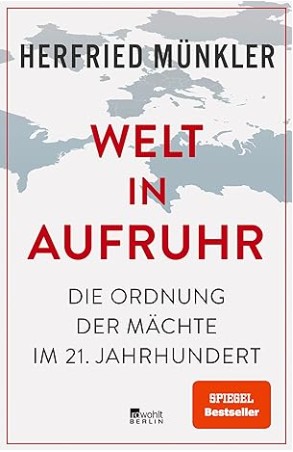
Herfried Münkler: Welt in Aufruhr, Rowohlt 2023.
Revisionistische Bestrebungen
Sehr aufschlussreich und faktengesättigt sind dabei Münklers Ausführungen über Revisionismus (S. 72ff). Unter Revisionismus sind Bestrebungen zum Widerruf vertraglicher Abmachungen zu verstehen (Wikipedia). In den Friedensverträgen von Münster und Osnabrück von 1648 und im Wiener Kongress von 1815 sei es gelungen, Friedensordnungen zu schaffen, die keine Macht mit dem Vorbehalt zurückließ, bei nächster Gelegenheit doch noch zu ihrem „Recht“ zu kommen.
Aber nach dem deutsch-französischen Krieg mit dem Friedensschluss von 1871 war Frankreich revisionistisch gesinnt. Vor allem aber wurde nach dem ersten Weltkrieg Deutschland durch den Versailler-Vertrag zu einer revisionistische Macht, aber auch Russland, das trotz seines hohen Blutzolls im Ersten Weltkrieg nicht an den Verhandlungen beteiligt worden war. Zudem war Italien revisionistisch gesinnt, weil es nicht die zugesagten Gebiete an der dalmatischen Küste erhalten hatte. (Nur die Türkei, die sich dem vorgesehenen Kurdenstaat widersetzte, war mit ihren Vorbehalten erfolgreich.) Münkler führt diese Beispiele für revisionistische Bestrebungen an, ohne wirklich die psychologischen und taktischen Mechanismen zu analysieren. So war es ja nicht kühle machtstrategische Unzufriedenheit, die Hitler den zweiten Weltkrieg beginnen ließ, sondern Hitler nutzte die Kränkungserfahrungen durch den Versailler Vertrag propagandistisch für seine irrationalen Kriegsziele aus.
Nach dem zweiten Weltkrieg versuchte man erst gar nicht, eine Friedensordnung zu etablieren. Und als diese Möglichkeit nach der Wende von 1989 von Italien und Polen ins Gespräch gebracht wurde, erfuhr dieses Ansinnen eine scharfe Zurückweisung durch die USA. Man hoffte vielmehr auf die pazifizierenden Wirkungen einer umfassenden wirtschaftlichen Einbindung. De facto hat nun aber Russland bzw. Putin (!) revisionistische Ziele offenbart.
Aus meiner Sicht kann das Thema Revisionismus nicht ohne eine Analyse der „politischen Gefühle“ sinnvoll bearbeitet werden. Inwieweit speisten sich die diversen revisionistischen Bestrebungen durch das Gefühl der ungerechten Behandlung? Was nährte diese Gefühle? Was hätte sie mildern können? Welche Rolle spielen Narrative? Und wer verbreitet (aus welchen Gründen) welche Narrative?
Hat, um nur ein prominentes Beispiel zu nennen, die Äußerung von Obama am 25. März 2014, in der er Russland als Regionalmacht, regional power, bezeichnete, Öl ins Feuer revisionistischer Gefühle und Kräfte gegossen?
blind
Wie kann revisionistischen Bestrebungen begegnet werden?
Potenziell friedensgefährdenden revisionistischen Bestrebungen kann nach Münkler in dreierlei Weisen begegnet werden: durch Wohlstandstransfer, Appeasement und Abschreckung und deren Kombinationen.
- Als Beispiel für Appeasement führt Münkler den Friedensschluss Israels mit Ägypten von 1979 an (Land gegen Frieden), wobei hier der Begriff nicht ganz passt, denn es kam hier (bemerkenswert genug!) schlicht zu einem Friedensschuss nach 2 Kriegen (dem 6‑Tage-Krieg von 1967 und dem Jom-Kippur-Krieg von 1973), so dass man weder Ägypten in den anschließenden 6 oder nur 5 Jahren Waffenstillstand (das Camp-David-Abkommen war bereits 1978) als eine „revisionistische Macht“ wird bezeichnen können, noch die Bereitschaft, besetztes Land zurückzugeben im Interesse eines dauerhaften Friedens, als „Appeasement“. Und natürlich spielten auch wirtschaftliche Vorteile eine Rolle, sowohl aus sich eröffnenden wechselseitigen Handels- und Verkehrsbeziehungen (in der Zielsetzung mehr als dann in der Wirklichkeit) als auch und vor allem durch die (belohnende) Unterstützung beider Staaten durch die USA.
Auch im Minsker-Abkommen von 2015 sieht Münkler Elemente von Appeasement, „insofern es … europäische Zugeständnisse in der Krimfrage für eine Beruhigung im Donbas ins Spiel“ brachte. (S. 81) Ähnlich wie Hitler sich nach dem Münchner Abkommen von 1938 nicht vertragstreu gezeigt hat, so gilt dies auch für Putin. Allerdings habe die Ukraine die Zeit nach dem Minsker Abkommen mit Hilfe der USA für Training und Aufrüstung ebenso genutzt, wie Chamberlain mit einer „entschiedene[n] Politik der Aufrüstung“ begann, „ohne die Großbritannien die Luftschlacht über England im Sommer 1940 wahrscheinlich nicht gewonnen hätte.“ (S. 82)
- Als überraschendes Beispiel für den Verzicht auf Revisionismus auf Grund von Wohlstandsgewinnen nennt Münkler die Westdeutschen: „das erreichte Wohlstandsniveau war die Grundlage dafür, dass sie Ende der 1960er Jahre der Ostpolitik Willy Brandts zustimmten“ (S. 78). Ob hier nicht auch die Kriegsschuld und somit Werte eine Rolle gespielt haben? Mitgefühl und ein Sinn für Gerechtigkeit etwa, die sagten, dass Polen nun in gesicherten und anerkannten Grenzen existieren können sollte? Auch wenn Münkler die Orientierung an „Werten“ für problematisch hält (s. unten), sollte er sie doch nicht in ihren realen Wirkungen negieren. Es ist vermutlich eine offene sozialpsychologische Frage, wie stark die Faktoren „erreichtes Wohlstandsniveau“ bzw. moralische Intuitionen von Mitgefühl und Gerechtigkeit wirksam waren.
Treffenderweise thematisiert Münkler die Hoffnung, die in Deutschland verbreitet war, dass der Import von russischem Gas und Öl zu einer gegenseitigen Abhängigkeit führen würde, die auch Russland nicht aufs Spiel setzen würde. Münkler, der sich hier mit Bewertungen zurückhält, scheint diese Strategie nicht grundsätzlich für naiv zu halten, sondern beschreibt sie nüchtern als eine Option neben Appeasement und Abschreckung. Vielleicht kann man sogar sagen, dass es den Versuch wert gewesen sei, zumal wenn das Risiko stärker begrenzt worden wäre.
Ein Problem bei der Hoffnung auf Wohlstandsgewinne war auch, dass diese vorrangig bei den Oligarchen landeten, die ihr Geld aber im Westen ausgaben, so dass es nicht zu einem „Durchsickern des Wohlstandes in die breite Bevölkerung kam“ (S. 86) und damit nicht zur „Auflösung von Ressentiments“ – wobei sich hier wiederum die Frage stellt, ob Ressentiments bei der Bevölkerung das Problem waren oder nicht vielmehr das gezielte Wachrufen solcher Gefühle durch Putin. Münkler sagt an anderer Stelle selbst, dass in autokratischen Systemen die Menschen leidensbereiter seien. Die Tatsache, dass Putin im Blick auf den Krieg in der Ukraine von einer „Spezialoperation“ sprach (und teilweise noch spricht) und dass er primär Soldaten aus entlegenen Provinzen und unter Strafgefangenen rekrutierte, weist darauf hin, dass er jedenfalls nicht mit einer sonderlichen Kriegsbegeisterung rechnete. So scheint ausgerechnet an der einen Stelle, in der Münkler politische Gefühle thematisiert und zurecht darauf hinweist, dass Wohlstandstransfer nicht alles ist, die Anwendbarkeit auf die russische Bevölkerung sehr fraglich. Ansonsten hat er völlig Recht, dass ein Wohlstandstransfer womöglich nicht „Wut und Zorn“ kompensieren kann, „die in «heruntergeschluckter» Form als Groll von langer Dauer sind“ (S. 87).
- Abschreckung ist mit den höchsten Kosten verbunden, da auf eine „Friedensdividende“ weitgehend verzichtet werden muss (S. 83). Dies muss von der Bevölkerung erst einmal „akzeptiert werden“. Außerdem besteht immer die Gefahr, dass „der abzuschreckende Revisionist sie nicht als Abschreckung, sondern als Bedrohung wahrnimmt“ (S. 83 Hervorhebung von mir, G. R.). „Das ist das Dilemma einer Politik der Abschreckung, die im Nachhinein freilich, wenn der Revisionist den Krieg begonnen hat, in der Öffentlichkeit als einzig sinnvoller Umgang mit der Herausforderung dargestellt wird …“ (S. 84). Dies ist eine sehr erhellende und relevante Beobachtung.
blind
Pentarchie als Weltordnung?
Konnte die Zeit des Kalten Krieges als eine binäre Welt beschrieben werden, kamen die USA nach der Wende in die Nähe einer Vormachtstellung, für die die Analogie zum römischen Reich nahelag. Mit dem (Wieder-)Erstarken Chinas aber ist die Welt in eine multipolare Weltordnung eingetreten. Nach Münkler gibt es generell eine Tendenz zu fünf Weltmächten, Pentarchien, die eine friedenssichernde Wirkung haben. Dabei kann durchaus eine Macht durch eine andere ersetzt werden, ohne dass die Fünfzahl und der Friede im Ganzen gefährdet werden.
Als Beispiele für Pentarchien (S. 196f) können schon aus dem 15. Jahrhundert die Konstellation von Venedig, Mailand, Florenz, Neapel und dem Papsttum genannt werden,
sowie nach dem Westfälischen Frieden: Wiener Kaiserhaus, Spanien, Frankreich, England und Schweden;
im 19. Jahrhundert verschoben sich die Kräfte letztlich hin zu einer Pentarchie von Russland, Deutschland, Österreich-Ungarn, Frankreich und England.
Münkler erörtert nun die Frage, wie es „zum Versagen des Gleichgewichtsmechanismus in der europäischen Pentarchie“ und damit zum 1. Weltkrieg kam (S. 202, Hervorhebung von mir, G.R.).
blind
Der 1. Weltkrieg – ein Versagen der europäischen „Pentarchie“?
„Die Frage danach ist nicht identisch mit der nach der Schuld am Krieg“ betont Münkler. Nicht erwähnt wird allerdings die Möglichkeit, dass die Staaten in den Krieg hineingestolpert sind – völlig unabhängig (nicht von Bündnisverpflichtungen und vielem anderen, aber) von so etwas wie einer „Pentarchie“. Jedenfalls interessiert sich Münkler vor allem für die Frage, warum Großbritannien nicht „an seiner Rolle als «Zünglein an der Waage» festhielt und sich als balancierender Fünfter verstand“ (S. 202).
Münkler weist darauf hin, dass in „einem Teil der Forschungsliteratur“ die Verletzung der Neutralität Belgiens im Rahmen des Schlieffenplans als Grund für den Kriegseintritt Englands angegeben wird.
Münkler stellt daneben (ausführlicher) die Auffassung, es könne „der englischen Politik seit Beginn des 20. Jahrhunderts darum [gegangen sein], den weiteren Aufstieg Deutschlands zu blockieren“ (S. 204). Münkler bezieht sich auf die sogenannte „Thukydides-Falle“, die darin besteht, sich wegen des erstarkenden Gegners genötigt zu sehen, rechtzeitig noch die eigene Überlegenheit auszuspielen – so wie Thukydides es im Blick auf Sparta gegenüber dem prosperierenden Athen beschrieb (vgl. S. 46).
„Dieser Sicht zufolge“ wäre die Pentarchie gescheitert, „weil die Macht des Ausgleichs und der Balance mit Blick auf ihre eigenen Interessen die ihr zukommenden Aufgaben nicht mehr erfüllte und in einen Krieg eintrat, den doch gerade sie hätte begrenzen sollen.“ (S. 204)
Diese Sicht, die sich Münkler nicht explizit zu eigen macht, für die er allerdings auch keine Quellen nennt und die er relativ ausführlich darstellt, ist gelinde gesagt höchst fragwürdig.
1. Englands Entscheidung zum Kriegseintritt stand auf Messers Schneide, wie Münkler selbst in seinem großen Werk zum Krieg schreibt: „Dennoch war 1914 nicht von Anfang an klar, ob es in der liberalen Regierung unter Herbert Henry Asquith eine klare Entscheidung für den zunächst keineswegs populären [!] Kriegseintritt geben würde. Bis zum deutschen Einmarsch in Belgien blieb das offen; erst die Verletzung der belgischen Neutralität machte es der politischen Führung Großbritanniens leicht, die Unterstützung der Bevölkerung für diesen Schritt zu gewinnen.“ (Der große Krieg, Berlin: Rowohlt 2014, S. 77). Auch die genaue Nachzeichnung der Tage vor Kriegsbeginn durch Christopher Clark macht deutlich: Noch am 31. Juli war die Mehrheit des Kabinetts gegen einen Kriegseintritt und wurde auch von „Bank- und Handelskreisen in London unterstützt“ (Die Schlafwandler, München: Deutsche Verlags-Anstalt 2013 S. 960). Am 1. August war sich John Morley „des Sieges der Nichtinterventionisten so sicher, dass er vor Churchill mit dem Sieg der »Friedenspartei« prahlte“ (Clark S. 961). Zudem hatte Großbritannien innenpolitische Probleme, insbesondere mit irischen Nationalisten. (Nach dem 1. Weltkrieg kam es dann von 1919–1921 zu einem blutigen Bürgerkrieg und 1922 zur Gründung des Irischen Freistaats.)
2. Es war die Rede von Außenminister Grey vor dem Unterhaus, die am 3. August die Entscheidung brachte: Er betonte die moralische Verpflichtung gegenüber Frankreich, weil die Freundschaft, die zwischen England und Frankreich entstanden sei, Frankreich ein Gefühl der Sicherheit gegeben habe. „Die französische Flotte befindet sich im Mittelmeer und ist seit einigen Jahren infolge des Gefühls von Vertrauen und Freundschaft, das zwischen beiden Ländern bestand, dort konzentriert worden.“ (zitiert nach Christopher Clark, a. O. S. 963) Grey erwähnte auch noch ein machtpolitisches Argument bezüglich der etwaigen Notwendigkeit, selbst im Mittelmeer aktiv zu werden. Dass die moralischen Argumente keine Rolle gespielt hätten (oder womöglich – wegen der Dominanz der geopolitischen Machtpolitik – nie eine Rolle spielen würden) wäre jedenfalls eine abwegige Behauptung.
3. Wenn England die Aufgabe zugeschrieben gewesen wäre (wer auch immer das nach Münkler so verfügt hätte), die Macht „des Ausgleichs und der Balance“ zu sein, so hätte es durch eine Neutralitätserklärung wie Deutschland sie forderte, dieses geradezu zum Krieg ermutigt. Und wäre England jener Aufgabe besser gerecht geworden, wenn es Deutschland gegen Belgien und Frankreich freie Hand gelassen hätte und neutral geblieben wäre? Hätte das zu einer „Begrenzung“ des Krieges geführt? Münkler sagt jedenfalls nicht explizit – wie das Niall Ferguson in seinem Buch The Pity of War tatsächlich schlussfolgerte -, dass eine Neutralität Englands und ein Sieg Deutschlands über Frankreich und Russland historisch gesehen begrüßenswerter gewesen wären; und erst recht sagt Münkler nicht – denn das würde natürlich seiner Hypothese, dass Großbritannien Deutschland als bedrohliche Macht empfand, krass widersprechen -, dass selbst ein siegreiches Deutschlands für Großbritannien keine Gefahr bedeutet hätte. Genau dies ist nämlich die Auffassung von Ferguson. Dieser schließt sein Buch (dt. Übersetzung: Der falsche Krieg, München 2013) mit den Worten: „Indem sie 1914 gegen Deutschland in den Kampf zogen, halfen Asquith, Grey und ihre Kollegen, dafür zu sorgen, daß Großbritannien, als Deutschland schließlich die Vorherrschaft auf dem Kontinent erreichte, nicht mehr stark genug war, dazu ein Gegengewicht zu bilden.“ (S. 514). In jedem Fall hätte man im Falle der Neutralität Großbritanniens wohl kaum von einer gelungenen Aufrechterhaltung einer Pentarchie sprechen können.
blind
Pentarchie im 21. Jahrhundert?
Das Vorkriegseuropa scheint genau das nicht zu sein, was Münkler in ihm sehen will: Eine Pentarchie, die bei rollengerechtem Verhalten von Großbritannien funktionsfähig geblieben wäre. Das ist nicht nur von historischer Bedeutung, denn Münkler konstatiert bzw. erwartet wiederum eine Pentarchie, in der „China, Russland, Indien, die USA und die Europäische Union die Weltordnungsmächte des 21. Jahrhunderts sein werden“ (S. 406). Und hier fällt es nach Münkler, Indien zu, „Zünglein an der Waage“ zu sein (S. 456). Da er selbst Indien „die große Unbekannte“ nennt, scheint es noch nicht so weit zu sein, dass Indien zu den Mächten gehört, die „die Weltordnung prägen und kontrollieren“. Also leben wir derzeit ohne eine Pentarchie als Weltordnung. Ist die Weltlage deshalb instabil? Wohl eher aus anderen Gründen. Auch das Bild des „Clubs“ (z. B. S. 455) für diese fünf Mächte scheint völlig verfehlt, als würden sie vertrauten Umgang miteinander pflegen und hätten sie nicht außerhalb dieses „Clubs“ die eigentlichen Freunde.
Münkler strapaziert das Konzept der Pentarchie noch weiter, indem er vermutet, dass sich auch innerhalb der EU eine Fünferkonstellation entwickeln könnte, zu der Frankreich, Deutschland, Polen, Italien, Spanien gehören würden. (S. 453) Denn nur diese könnten tatsächlich eine Kraft in der globalen Pentarchie bilden.
Münkler diskutiert nicht, warum auch im Falle einer Kooperation ein Fünferbündnis sinnvoll sein sollte. Hier käme es doch auf gute Kooperation an, und nicht auf die gegenseitige Beschränkung der Macht. Warum sollten das nicht genauso gut 2, 3 oder mehr sein können, wenn sie denn gemeinsame Werte und Interessen, ein gemeinsames Narrativ besitzen? Auch die Zahl von Bundesstaaten oder Bundesländern oder Departments spielt für die gemeinsame Außenpolitik offenkundig keine Rolle. In einer Weltordnung, einer Pentarchie kann und wird es verschiedene und gegensätzliche Interessen geben, in einer Staatengruppe, die als eine Macht in der Pentarchie auftreten will, wäre genau das sehr problematisch.
Neugierig macht der Versuch Münklers (jenseits von modelltheoretischen Überlegungen) die identitätsstiftenden Narrative der Ukraine, Russlands, der USA und Chinas zu skizzieren.
blind
Nationale Narrative – wozu sind sie gut?
Das ukrainische und das russische Narrativ befinden sich gegenwärtig in einer Um- und Neubildung, sind also nicht über längere Zeit organisch gewachsen. Das Konstruierte und Gewollte ihrer aktuellen Narrationsbildungen zeigt sich etwa daran, dass historische Kontingenzen verdeckt und überspielt werden, die Historie geglättet und teleologisch ausgerichtet wird.
Im Falle der USA gibt es wenig Substanzielles zu berichten. Kaum hat Münkler das US-Amerikanische „Narrativ“ benannt, nämlich durch soft power weltweit Demokratisierungsprozesse, individuelle Freiheit und wirtschaftlichen Wohlstand zu fördern (S. 268), da dekonstruiert er dieses Narrativ bereits durch den Verweis auf die zahlreichen Beispiele von Interventionen aus egoistischem und machtpolitischem Interesse – und geht über zur Darstellung eines sehr speziellen und äußerst dubiosen Narrativs, nämlich dem der Neocons, der Vertreter eines Neokonservatismus. Diese waren nämlich, so Münkler, der Auffassung, dass durch lange Friedenszeiten den USA, wie schon dem alten Rom, der Niedergang drohe. „Die Kriegsorientierung, der die USA während der Präsidentschaft von George W. Bush frönten, war eine von den Neocons angeratene Versicherung gegen den drohenden Niedergang.“ (S. 270) Münkler stellt abschließend Positionen des Journalisten und Politikberaters Robert Kagan dar, der „neokonservativen Zirkeln“ zuzurechnen ist (aktuell allerdings eindringlich vor der Gefahr einer Trump-Diktatur warnt). Inwiefern die politischen Einschätzungen von Kagan Bausteine zum US-amerikanische „Narrativ“ beisteuern, bleibt von Münkler undiskutiert.
Bei der herausfordernden Aufgabe der Skizzierung eines chinesischen Narrativs rettet sich Münkler in die Darstellung des ohne Zweifel bedeutenden Buches von ZHAO Tingyang (der Nachname steht am Anfang). Münkler stellt das Tianxia-Prinzip „Alles unter einem Himmel“ mäßig verständnisvoll dar und entnimmt ihm mehr chinesischen Dominanzwillen als es der Wortlaut hergibt. Wer Münkler liest, wird kaum zur Lektüre des Buches von Zhao motiviert. Dabei ist es hochinteressant und lehrreich, sich in ein alternatives Denkmodell im Kontext Globalpolitik zu vertiefen. Völlig zutreffend ist die Kritik Münklers, dass es an kritischen Passagen z.B. zur (ehemaligen) Kolonialmacht Russland oder (meine Ergänzung) gar zum heutigen China völlig fehlt. Allerdings ist offenkundig, dass das Tianxia-Prinzip mit seiner Betonung der gewaltfreien Kooperation nicht der staatlichen Politik Chinas entspricht und Zhao sagt explizit: „Das heutige China ist ein souveräner Staat, kein Tianxia, Argwohn gegenüber dem heutigen China kann keine Zweifel am Tianxia-System begründen.“ (Alles unter dem Himmel S. 235)
Wer braucht eigentlich ein nationales Narrativ? Dass die Ukraine um eine Standortbestimmung ringt, ist sehr verständlich, dass Putin ein Narrativ braucht, ist plausibel. Aber müssen pluralistische Gesellschaften Narrative pflegen? Brauchen sie solche? Ja, können sie sich solche überhaupt leisten, wenn sie Minderheiten nicht ausgrenzen wollen? Wir sind hier mitten in dem Themenfeld von Leitkultur versus Verfassungspatriotismus, aber dies wird von Münkler nicht einmal angedeutet, so dass unklar bleibt, welche Bedeutung er den Narrativen zuschreibt.
blind

ZHAO Tingyang: Alles unter dem Himmel,
Suhrkamp Verlag 2020
Demokratien im Nachteil?
Münkler betont mehrfach, dass Autokratien und Demokratien unterschiedliche spezifische Stärken und Schwächen haben:
„Autokraten haben Vorteile bei der Entwicklung langfristig angelegter Strategien; Demokratien sind im Vorteil, wenn es darum geht, die Vor- und Nachteile, Chancen und Risiken solcher Strategien abzuwägen.“ (S. 24)
In Demokratien spielt „die Gegenwart eine deutlich größere Rolle … als der Blick auf das, was in Zukunft eintreten könnte“ (S. 71f).
Zudem dreht sich die Politik in Demokratien aufgrund der Wählerorientierung „eher um innen- als um außenpolitische Fragen“ (ebd.). Diese Analyse ist bedeutsam und verdient eine ständige Reflexion durch verantwortliche Politiker in Demokratien. Es dürfte ihnen die Aufgabe zufallen, die Bevölkerung bei langfristigen Herausforderungen, zu denen sicher die Klimaveränderungen gehören, „mitzunehmen“ (wie es so unschön heißt), indem sie durch Information und kluges Eingehen auf die unvermeidlichen Emotionen eine sachgerechte Politik begleiten.
Nutzlose Werte?
Durch das Buch zieht sich eine Skepsis gegenüber dem Geltendmachen und womöglich sogar auch der Motivation durch Werte.
„Je weniger von Werten die Rede ist, desto leichter werden sich Regeln im Umgang der großen Mächte miteinander festlegen lassen. Man muss sich also entscheiden, was einem wichtiger ist: das folgenlose Geltendmachen von Werten oder die Verständigung auf verbindliche Regeln.“ (S. 26)
Allerdings reflektiert Münkler nicht, dass Regeln wertebasiert sind. Sie dienen ja z.B. dem Frieden oder der Wohlstandsmehrung etc. Zudem setzt die Beachtung der Regeln den Wert der Vertragstreue voraus. Münkler schreibt völlig zurecht:
„Die politischen und kulturellen Eliten des globalen Südens glauben «dem Westen» nicht, dass er es mit den von ihm proklamierten Werten wirklich ernst meint, jedenfalls nicht für sie im «Süden», und sind deswegen darauf bedacht, sich aus den geopolitischen Konflikten des Nordens herauszuhalten.“ (S. 119)
Bedeutet eine solche Analyse nicht, dass die angesprochenen Länder sich wünschen würden, der Westen würde die Werte auch ihnen gegenüber beachten? Bestätigen sie damit nicht die Werte als Werte und kritisieren die Heuchler?
Werte scheinen für Münkler – in der internationalen Politik jedenfalls – nur dann „sinnvoll“ zu sein, wenn man sie auch durchsetzen kann. Wenn Werte nicht durchgesetzt werden können, weil kein „Hüter“ da ist, der bereit wäre, seine Macht und seine Kraft für sie einzusetzen, sind sie für Münkler „bloßer Gestus“, Mahnungen und Apelle, die nichts bringen (vgl. S. 437). So ist für ihn auch
das „Dilemma einer «wertorientierten Außenpolitik»: Letzten Endes ist sie auf einen Hüter angewiesen, den es aber auf Dauer nicht gibt – oder sie muss dessen Aufgaben selbst übernehmen, womit sie aber strukturell überfordert ist“ (S. 190).
Der Wertebegriff von Münkler scheint moralistisch verengt zu sein. Er verkennt, dass Politiker wie alle Menschen notwendigerweise mit Gerechtigkeit und Fairness argumentieren, auf zugefügtes Leiden (Mitgefühl) verweisen oder mangelnder Solidarität beklagen etc.
Dass jedes Land wie jeder Mensch immer auch die eigenen Interessen verfolgt, ist dazu nicht der geringste Widerspruch.
Globalisierung am Ende?
Noch in einem letzten wichtigen Punkt kann ich Münkler nicht folgen. Er behauptet recht pauschal, dass das „Projekt eines offenen Weltmarktes … vorerst als gescheitert angesehen werden“ müsse (S. 423). Nun hat sich allerdings die wirtschaftliche Vernetzung in einer atemberaubenden Weise in den letzten Jahrzehnten entwickelt. Bedeutet ein Boykott Russlands und eine angestrebte geringere Abhängigkeit von einigen Rohstoffen aus China schon ein Scheitern des offenen Weltmarktes? Wird nicht selbst das Embargo gegen Russland von findigen Firmen umgangen und von vielen Ländern gar nicht mitgetragen? Die wirtschaftliche Globalisierung mag Rückschläge erleiden und ihre Zukunft ist offen, für einen Abgesang ist aber die Zeit keineswegs gekommen.
Münkler meint, auch politisch sei die „Eine-Welt-Vorstellung“ überholt, weil „sich die Vereinten Nationen als zu schwach und zu zerstritten erwiesen“ um die Aufgabe des Hüters wahrzunehmen (S. 437). Niemand bestreitet die Probleme der Vereinten Nationen, allen voran die Blockademöglichkeit des Sicherheitsrates durch das Vetorecht der fünf ständigen Mitglieder. Allerdings wird dabei doch wohl die beharrliche Arbeit der vielen Unterorganisationen nicht ausreichend bedacht. Und könnte man nicht im Gegenteil auch darüber staunen, dass es diese Organisation mit ihren Kompetenzen überhaupt gibt? Auch der Internationale Strafgerichtshof (außerhalb der UNO) wäre hier zu würdigen. Noch ist auch hier nicht der Punkt gekommen, in dem ein Engagement für die UNO als überflüssig und nutzlos betrachtet werden könnte.
Das Buch für Münkler ist denen zu empfehlen, die sich für eine relativ abstrakte, eben „modelltheoretische“ Sicht auf Geopolitik interessieren.
Die Frage, wie Kriege in der Vergangenheit beendet worden sind, wird kompakt von Jörn Leonhard erörtert. Bei ihm kommen Fragen der Kommunikation zwischen den Mächten und „politische Gefühle“ zu ihrem Recht. Starke Empfehlung!
Mit Recht hochgelobt wird auch das Werk von Nikolai Epplée: Die unbequeme Vergangenheit. Ein längerer erster Teil beschreibt das Ringen in Russland um einen angemessenen Umgang mit der Vergangenheit, vor allem der Revolution von 1917 und dem Stalinterror. Weitere Kapitel (zweiter Teil) beschäftigen sich sodann mit der „Vergangenheitsarbeit“ in Argentinien, Spanien, Südafrika, Polen, Deutschland und Japan. Der dritter Teil dient dann der Zusammenschau. Hier geht es um tiefschürfende Aspekte etwa der „Arbeit des Akzeptierens“, des „Aushandelns der Wahrheit“ oder der „Infrastruktur“ des Erinnerns. Die Rede von Narrativen erweckt den Eindruck einer Abgeklärtheit, an die im Streit um Formen des Gedenkens an die Opfer von Gewalt noch nicht zu denken ist.
Eine Rezension zu Martha Nussbaums Buch Political Emotions findet sich hier.

Jörn Leonhard: Über Kriege und wie man sie beendet, München: C.H.Beck 2023.




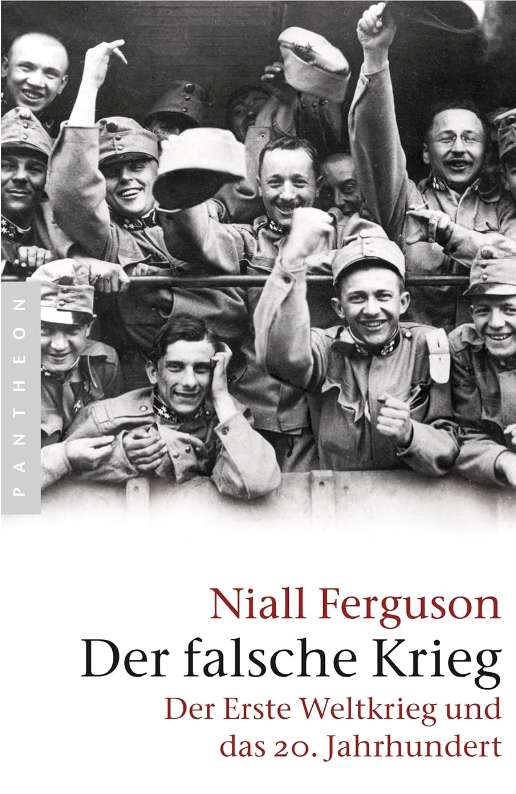



[…] 19)https://ethik-und-anthropologie.de/2023/12/31/herfried-muenkler/; https://www.schaffermahlzeit.de/media/1192/rede-matthias-claussen-generalversammlung-am-05022019docx.pdf […]